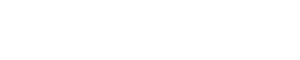Top Logo Banner
Loveparade – Wenn Berlin zum Dancefloor der Welt wurde

In den 90ern hatte Berlin einen Soundtrack: das wummernde Bassgewitter der Loveparade. Was 1989 als kleine Technoparty mit ein paar Hundert Leuten auf dem Kurfürstendamm begann, wuchs im Laufe des Jahrzehnts zu einem der größten Straßenfeste der Welt – und wurde zum Symbol für Freiheit, Einheit und natürlich für exzessives Feiern.
Einmal im Jahr verwandelte sich die Hauptstadt in ein buntes Meer aus Raver-Outfits, Neon, Glitzer und nackter Haut. Aufwendig dekorierte Trucks – die legendären „Love Trucks“ – rollten die Straße des 17. Juni entlang, zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor. Oben drauf: DJs, riesige Lautsprecher, tanzende Menschen. Drumherum: Hunderttausende, die in Ekstase hüpften, als gäbe es kein Morgen.
Der Soundtrack war klar: Techno, Trance, House. Namen wie Dr. Motte, Westbam oder Marusha wurden zu Helden der Szene. Songs wie Somewhere over the Rainbow oder Sonic Empire liefen auf Dauerschleife und brannten sich als Hymnen ins kollektive Gedächtnis.
Doch die Loveparade war mehr als nur eine Party. Sie war ein politisches Statement – offiziell angemeldet als „Demonstration für Frieden, Freude und elektronische Musik“. Gerade in den 90ern, nach der Wiedervereinigung, stand sie für ein neues, weltoffenes Berlin. Millionen Jugendliche aus aller Welt pilgerten in die Stadt, um Teil dieser gigantischen, friedlichen Massenbewegung zu sein.
Natürlich gab es auch Kritik: zu laut, zu chaotisch, zu viele Müllberge. Aber im Kern blieb die Loveparade ein Symbol dafür, dass die 90er eine Ära waren, in der man glaubte, mit Musik und Gemeinschaft wirklich die Welt verändern zu können.
Heute lebt die Loveparade nur noch in Erinnerungen (und als Nachfolger wie „Rave the Planet“). Aber für alle, die dabei waren, war sie mehr als ein Festival – sie war ein Lebensgefühl. Berlin im Ausnahmezustand, ein ganzer Sommer in Bass getaucht.