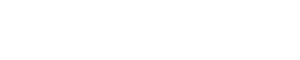Top Logo Banner
Ed Hardy – Wenn T-Shirts wie Tattoo-Studios aussahen

Es gab eine Zeit in den 2000ern, da konnte man schon von weitem sehen, ob jemand Ed Hardy trug: knallige Farben, glitzernde Strasssteine und großflächige Tattoo-Motive mit Totenköpfen, Tigern und Rosen. Ed Hardy war nicht einfach Mode – es war ein wandelndes Rock’n’Roll-Tattoo auf Baumwolle.
Die Marke basierte auf den Designs des US-Tätowierers Don Ed Hardy, wurde aber von Designer Christian Audigier zu einem internationalen Phänomen hochgejazzt. Promis wie Madonna, Britney Spears oder Paris Hilton liefen darin herum, und plötzlich wollte auch die halbe Party-Generation aussehen wie frisch aus einem Tätowiermagazin gefallen.
Typisch waren T-Shirts, Caps und Hoodies, die mit Sprüchen wie „Love Kills Slowly“ bedruckt waren – dazu funkelnde Strass-Applikationen, die im Clublicht mindestens so sehr glänzten wie die Discokugel. Ed Hardy war das Gegenteil von Understatement: Wer diese Marke trug, wollte gesehen werden. Und zwar jetzt.
In Deutschland wurde Ed Hardy spätestens durch Reality-TV und Proll-Glamour richtig groß. Auf Malle-Partys, in Großraumdiskotheken oder beim Samstagabend-Ausgehen sah man ganze Gruppen in passendem Tiger-Look. Man könnte sagen: Ed Hardy war die Uniform der 2000er-Partyszene.
Natürlich kam irgendwann die Gegenbewegung: Was zuerst als cool und rebellisch galt, kippte schnell ins Klischee. Bald stand Ed Hardy für „Proll-Luxus“ und landete in Comedy-Programmen und Karikaturen.
Heute hat die Marke eher Kultstatus als echte Street-Credibility. Aber wer damals ein Ed-Hardy-Shirt trug, fühlte sich kurz wie ein Rockstar – auch wenn man nur auf dem Dorf in die Dorfdisco ging.